Eine Kurzversion dieses Essays erschien in dem Wirtschaftsmagazin “brand eins” (brand eins, 15. Jahrgang, Heft 03 März 2013, S. 110 – 113)
Wie verändert sich unsere Arbeitswelt? Die digitalen Technologien haben uns neue Möglichkeiten der Kollaboration und Flexibilität gebracht, agile Strukturen und weltweite Vernetzung. Zugleich steigt der Anforderungsdruck der globalen Märkte. Die ständige Suche nach Einsparmöglichkeiten, Steigerung der Effizienz, von Jahr zu Jahr steigende Umsatzziele werden von vielen Menschen als Beschleunigung empfunden. Sind dies Einzelfälle oder stehen sie für eine strukturelle Veränderung der Arbeitswelt? Sind wir eine Gesellschaft am Limit? Woran würden wir es merken, wenn wir uns der Grenze nähern? Eine Spurensuche.
„Jeder gibt immer sein Bestes.“ Diesem Satz, einem Leitsatz der neuen Arbeitswelt und Mitarbeiter-Motivation, möchte man spontan beipflichten. Natürlich, denkt man. Was sonst. Jeder gibt immer sein Bestes.
Bei genauerer Betrachtung aber enthüllt der harmlose Satz in seiner Grammatik einen fragwürdigen Anspruch: Das Subjekt „Jeder“ bezeichnet die maximale Anzahl von Subjekten. Das Temporaladverb „immer“ ist der Ausdruck des zeitlichen Maximums. Das „Beste“ wiederum ist ein Superlativ der Qualität, mit dem Possesivpronomen „sein“ an das Subjekt gebunden und Objekt zum Verb „geben“. Der Satz steht im erzieherischen Imperativ, der keinen Widerspruch duldet: „Jeder gibt immer sein Bestes.“ Er besteht in allen sprachlichen Bestandteilen aus Maximierung. Der Satz ist eng und dicht, da ist kein Raum. Er ist totalitär.
Digitale Technologie als Katalysator
Vor dem Hintergrund derzeitiger technologischer Möglichkeiten entfaltet dieser Satz eine besondere Brisanz. Es ist inzwischen tatsächlich möglich, dass jeder immer erreichbar, ansprechbar, verfügbar ist. Informationen und Kommunikationswege sind nicht mehr an Raum und Zeit gebunden, auch Datengrenzen gibt es praktisch keine mehr. Kein Arbeitnehmer kann sich inzwischen darauf zurückziehen, dass ihn eine Nachricht nicht erreicht hat. Jeder gibt immer sein Bestes. Es ist klar, dass es nicht die Technologie ist, die hier eine Grenze setzt. Die Technik kann immer ihr Bestes geben. Aber kann der Mensch das auch? Und wenn ja: Zu welchem Preis?
Beobachtungen
Eine Freundin hat in einem Unternehmen in Berlin gearbeitet. Eine qualifizierte, kompetente Frau, die auch bereit ist, Führungsverantwortung zu übernehmen. Für einen Langzeitkunden musste plötzlich kurzfristig ein Projekt über die Bühne gebracht werden, in eigentlich viel zu kurzer Zeit, mit eigentlich zu vielen Aufgaben und zu wenigen Leuten. Sie haben es trotzdem geschafft. Sie haben für ihren Langzeitkunden die Ärmel hochgekrempelt und es hinbekommen. Sie waren erschöpft und stolz, und das mit Recht. Herausforderungen gehören zum Berufsleben. Sie geben einem die Gelegenheit, über sich hinauszuwachsen. Es tut gut, wenn man etwas Unmögliches dann doch geschafft hat. „Positiver Stress“ nennt man es. Er ist die Würze eines Arbeitslebens. Er treibt uns an, im positiven Sinne.
Das Unternehmen, für das sie gearbeitet hat, hat dann aber dieses Projekt als Benchmark gesetzt. Der Zeit- und Personalaufwand für alle zukünftigen Projekte, die Jahresziele wurden von nun an nach diesem Ausnahmeprojekt kalkuliert. Es geht doch, hieß es. Das hatten sie ja eindeutig bewiesen.
„Ich habe nette Kollegen, ich liebe meine Arbeit, ich will das nicht aufgeben“, sagte meine Freundin noch letztes Jahr. Es muss irgendwie anders gehen, hat sie gedacht. Sie hat Gespräche geführt, ihrem Team den Rücken freigehalten, Verbesserungen vorgeschlagen, versucht, die Arbeitsprozesse umzustrukturieren und realisierbare Wege zu finden.
Schließlich hat sie doch gekündigt. Es geht nicht mehr, sagte sie. Am Ende hieß es: Sie oder ihre Arbeit. Es war ein trauriger Abschied, es flossen Tränen, auch bei ihr. Das Unternehmen wollte sie mit Geld zurückgewinnen. „Aber was nützt mir das Geld, wenn ich nicht mehr kann?“, sagt sie.
Gesellschaft am Limit
Sie ist – man kann es sich denken – nicht die einzige in ihrem Unternehmen. Andere werden bald folgen. Die Ursache liegt nicht in ihrer persönlichen Art, mit Anforderungen umzugehen. Die Ursache ist struktureller Natur. Das positive Leistungsklima des Unternehmens kippte in dem Moment, als die Maximalbelastung zum Durchschnitt gemacht wurde. Wenn der Ausnahmezustand die Benchmark ist, erzielt das kurzfristige Erfolge. Langfristig aber geht es auf die Substanz. Erst auf die Substanz der Mitarbeiter, dann auf die des Unternehmens.
Es kann nicht im unternehmerischen Interesse sein, wenn motivierte, kompetente, teamfähige und leistungsbereite Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, obwohl sie eigentlich bleiben wollen. Es kann auch nicht im Sinne eines Unternehmens sein, wenn andere gute, kompetente Fachleute gar nicht erst bei ihnen als Arbeitgeber zu arbeiten anfangen, weil sie sonst befürchten müssen, dass sie sich eines Tages zwischen ihrer Gesundheit und ihrer Arbeit entscheiden müssen.
Ein neues Phänomen: Die präventive Kündigung
Ich beobachte das zunehmend, wenn Menschen von ihrer Arbeit erzählen. „Mit jedem Kollegen, der kündigt, muss ich noch mehr Projekte übernehmen“, sagt ein Freund, der in der Energiebranche arbeitet. Die Stellen werden nicht neu besetzt, die Arbeit wird verteilt, Kundenanfragen kann er nun erst nach Wochen bearbeiten. Die Kunden fangen an, unzufrieden zu werden, wer kann es ihnen verdenken. Sein Arbeitsalltag besteht daraus, Feuer auszutreten. Nur die größten, für die kleinen Feuer hat er keine Zeit.
Die Freundin einer Freundin arbeitet seit Jahren in Hamburg bei führenden Werbeagenturen mit großen Markenkunden. Sie berichtet dasselbe. Immer schneller, immer mehr musste sie arbeiten, von Pitch zu Pitch. Sie war eine zeitlang krank. Sie erholte sich und kam wieder. Befasste sich mit Gesundheitsmanagement, schlug Verbesserungen vor. Versuchte, ob es nicht doch geht. Es ging nicht. Auch sie hat gekündigt.
Die Geschichten ähneln sich. Ist es Zufall? In den gängigen Burnout-Statistiken der Krankenkassen, die seit Jahren einen zunehmenden Anstieg langer Ausfallzeiten beklagen, tauchen diese Fälle präventiver Kündigungen nicht einmal auf. Sind das alles Low-Performer? Ich bezweifle das. Es ist nicht hohe Leistung an sich, die fähige Leute belastet. Es ist die immerwährend erwartete weitere Leistungssteigerung.
Dass Unternehmen von ihren Mitarbeitern hohe Leistungen erwarten, ist richtig und sinnvoll. Eine strukturell implementierte kontinuierliche Leistungssteigerung aber ist ein Experiment. Wir wissen nicht, ob das auf Dauer funktioniert und wohin es uns führt. Wie reagiert die Ressource Mensch unter diesen Bedingungen? Welche Auswirkungen wird es auf die Gesellschaft haben, auf Unternehmen, auf die Wirtschaft?
Spurensuche
2012 geriet ein Mitarbeiter-Bewertungssystem in den Fokus der Medien, das die Leistungssteigerung für die Mitarbeiter zum Grundprinzip macht. Thomas Radermacher, Betriebsrat bei dem Unternehmen Microsoft, spricht im August 2012 im ZDF im Rahmen eines Frontal21-Berichtes über das microsoftinterne Mitarbeiter-Bewertungssystem [s. Update*]: An das klassische Schulnotensystem angelehnt, müssten in jedem Jahr ein vordefinierter Prozentsatz der Mitarbeiter mit schlechten Noten bewertet werden, unabhängig von ihrer tatsächlichen Leistung. Dieses führe, so sagt er, zu einer starken Belastung der Mitarbeiter und zu einem hohen Anstieg langer burnout-assoziierter Ausfallzeiten. Warum belastet dieses Bewertungssystem auch leistungsbereite und an sich belastbare Menschen? Weil eine weitere Steigerung ihrer Leistung von Jahr zu Jahr erwartet wird. Weil sie niemals das Gefühl haben können, gut genug zu sein.
Rank and yank, up or out
„Stack ranking“ heißt diese Methode. Auch im Bankenwesen wird sie beispielsweise angewandt. Der Amerikaner Jack Welch, der über 20 Jahre lang CEO von General Electric war, machte die Methode populär. Jährlich entließ er je 10 % seines Managements. Mitarbeiter wurden nach einem vorab festgelegten Proporz in top, good und poor Performer eingeteilt und entsprechend aussortiert, „rank and yank“. Man kann auch sagen: Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Das System soll eine kontinuierliche Verbesserung der Performance erzielen, eine Art survival of the best Performer auslösen. Es ist fraglich, ob das auf lange Sicht gelingt. Denn die damit verbundenen Kollateralschäden können zum negativen Kostenfaktor für das Unternehmen werden. Der amerikanische Autor Kurt Eichenwald nennt das Stack Ranking das destruktivste Element der Managementkultur von Microsoft. Darin waren sich alle ehemaligen und gegenwärtigen Mitarbeiter des Konzerns einig gewesen, die er für eine Dokumentation für Vanity Fair interviewt hatte.
Gemeint war dabei nicht einmal die negative Auswirkung auf die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern die destruktive Wirkung auf das Unternehmen selbst: Der interne Konkurrenzkampf behindere eine kooperative, konstruktive Zusammenarbeit. Je besser das Team, umso schlechter das eigene Ranking. Projekte von Kollegen würden sabotiert anstatt unterstützt, Informationen zurückgehalten. Der Anreiz, mit anderen brillanten Programmierern zusammenzuarbeiten und brillante Ideen zu realisieren, gehe verloren. Sein Fazit: „In the end, the stack-ranking system crippled the ability to innovate at Microsoft“.
Eine verwandte Management-Technik ist „up or out“, auch bekannt als „grow or go“. Sie wird vor allem bei großen Unternehmensberatungen praktiziert. Wer in einer festgelegten Zeit nicht befördert worden ist, soll das Unternehmen verlassen. Auch Zielleistungsverträge schreiben oft eine Leistungssteigerung vor. Sie setzen sich zunehmend auch im Gesundheitswesen durch. Jeder zweite Chefarzt arbeitet laut der ARD-Filmdokumentation „Vorsicht Operation“ unter einem Zielleistungsvertrag, zum Teil mit vereinbarten Fallzahlsteigerungen. Zeitgleich gibt es immer mehr Ärzte, deren Verträge befristet sind.
Die Steigerung als Grundzustand
Diesen Management-Techniken liegt derselbe Mechanismus zu Grunde: Eine Steigerung wird als Grundzustand definiert, um eine immerwährende Optimierung der Performance zu erzielen – ohne Regeln für das mögliche Erreichen der Optimierungsgrenze zu definieren. Dies aber wäre nötig, um Folgekosten vom Unternehmen fernzuhalten. De facto wird dem Problem derzeit mit immer neuem Nachschub an Mitarbeitern begegnet. Zynisch könnte man sagen, ein gewisser Verschleiß ist einkalkuliert. Das ist bei einem Technologie-Unternehmen nicht anders als im Agentur-Gewerbe.
Kollateralschäden
Eine zeitlang funktioniert dies. Überspannt man den Bogen aber, fangen die Kosten an, den Nutzen zu überwiegen. Während in die von allen avisierte Richtung immer weiter optimiert wird, reißt an anderen Stellen das Gewebe des Organismus auf und es bilden sich im Unternehmen unberechenbare Brüche und Risse. Zum Beispiel ein Unternehmen, das Arbeitsabläufe zu sehr strafft und dies auf der anderen Seite mit Unzufriedenheit, Fluktuation und hohen Ausfallzeiten des Personals zahlen muss. Oder der Betrieb, der Abteilungen auslagert, die Verwaltung und die Beauftragung externer Firmen aber die Einsparung wieder auffrisst. Oder das Logistikunternehmen, das die Reviere der Kuriere über den neuralgischen Punkt hinaus vergrößert. Die feinen Risse im System, die das an anderer Stelle produzieren kann, bekam meine Nachbarin zu spüren: Der Kurier hatte kurzerhand ihre Unterschrift gefälscht, um das Paket zu quittieren und seine Auslieferungsziele zu erreichen. Wer weiß, was dort im Schatten noch passiert? Folgekosten wie diese, die an anderer Stelle des Unternehmens auftreten, müssen sinnvollerweise beachtet und mitkalkuliert werden.
Fragwürdige Unternehmenskultur
Die Filmemacherin Carmen Losmann hat in ihrer Dokumentation „Work hard play hard“ die Mechanismen dieser neuen Arbeitswelt dokumentiert, mit unerbittlicher, unkommentierter und nüchterner Kamera. Auch die hier dokumentierten Unternehmen stehen stellvertretend für eine allgemeine Entwicklung. Im Gespräch sagt sie, es sei ihr nicht darum gegangen, einzelne Unternehmen an den Pranger zu stellen, sondern es gehe ihr um die generelle Entwicklung der Arbeitswelt, für die sie exemplarisch sind.
In ihrer Dokumentation klagt niemand. Keiner der gefilmten Mitarbeiter oder Führungskräfte spricht über Belastung oder gar Burnout. Und doch zeigt die Dokumentation deutlich den Nährboden, auf dem so etwas gedeihen kann. Im Mitarbeiter-Training in den Bäumen gelobt ein Mitarbeiter, von jetzt ab Prozesse und Aufgaben schneller und zielführender zu erledigen, um für sein Unternehmen mehr Umsatz zu generieren. Eine „Mega-Wachstums-Mentalität“ gibt ein Konzernleiter in der Neujahrsansprache unter Applaus seiner Konzernmitarbeiter als Devise aus und es wird einem merkwürdig unwohl dabei. Es ist die Rede von operationalen Spitzenleistungen, die – „täglich“ – angestrebt werden. Eine Change Management Expertin erklärt ihre Vision der ständigen Verbesserung, die sie für das Unternehmen hege und dass sie diese „wirklich nachhaltig in die DNA jeden Mitarbeiters verpflanzen“ möchte.
Jemand liest ein Beispiel für einen Teamkodex vor und verspricht sich an signifikanter Stelle. Der O-Ton ist aussagekräftiger als jeder Kommentar es sein könnte: „Jeder ist verpflichtet, sein Bestes zu geben. Jeder übernimmt sich…“ (hier stockt er und setzt neu an): „übernimmt für sich und andere Verantwortung und sucht nach Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten“. Der Versprecher ist tatsächlich so passiert, die Regisseurin hat ihn nicht herausgeschnitten und im Film gelassen.
Growing Faster in a Fast-Growth Economy?
Ständige Verbesserung klingt gut. Doch ganz so einfach ist es bei näherer Betrachtung nicht. Gerade das Qualitätsmanagement zeigt dies: Aus jedem Einzelnen das Maximum herauszuholen bedeutet nicht automatisch, dass sich in der Summe auch das Optimum für das ganze Unternehmen ergibt. Es ist zum Beispiel nur bedingt sinnvoll, in einem Prozesschritt mehr Bauteile zu produzieren als im nächsten weiterverarbeitet werden können. Wichtiger als die maximale Einzelleistung ist, dass die Taktung der Prozesschritte sauber koordiniert ist. Wenn der Prozess nicht stimmt, kann der Einzelne dies mit seiner eigenen Leistung nicht auffangen, so sehr er sich auch anstrengt. Es gibt dann nichts Richtiges im Falschen.
Der amerikanische Physiker und Statistiker William Edwards Deming gilt als Pionier des prozessorientierten Qualitätsmanagements und hatte nach 1950 großen Einfluss auf Japans Automobilindustrie. Ausgerechnet er identifiziert als zwei der „sieben tödlichen Krankheiten eines Managementsystems“: performanceorientierte Mitarbeiter-Rankings wie das Stack Ranking und die Fixierung auf kurzfristigen Gewinn. Es ging Deming also um eine Verbesserung der Qualität, aber nicht um jeden Preis. Das Management sollte ebenso darauf achten, dass die Bodenhaftung und der Bezug nicht verloren gehen. Denn wenn die Gesamtkosten einer Maßnahme steigen, sinkt auch die Qualität.
Der Amerikaner Jack Welch, der das Stack Ranking populär gemacht hat, gilt auch als der Vater des Prinzips des Shareholdervalue als Unternehmensziel. Der Anfang des Shareholdervalue-Gedankens wird in einer Rede gesehen, die Jack Welch 1981 in New York hielt. Sie hieß „Growing Fast in a Slow-Growth Economy”. 2009 gab Jack Welch, inzwischen über 70-jährig, in einem Interview gegenüber der Financial Times und angesichts der Finanzkrise folgendes zu Protokoll: “On the face of it, shareholder value is the dumbest idea in the world. Shareholder value is a result, not a strategy… Your main constituencies are your employees, your customers and your products.” Er rät den Unternehmen nun – ob aus Altersweisheit oder aus feinem Gespür für Humor – statt auf „quarterly profit“ auf eine Zunahme der „longterm values“ der Unternehmen zu achten.
Was ist in der Zwischenzeit passiert? Vielleicht ist es genau das, was den Eindruck der Beschleunigung hervorruft: Was 1981 noch „Growing Fast in a Slow-Growth Economy” war, ist inzwischen zu einem “Growing even Faster in a Fast-Growth Economy“ geworden. Das eine geht. Das andere offenbar nicht.
Grenze und Schwelle
Es scheint tatsächlich so, dass wir an die Grenze von etwas geraten. Die Beobachtungen gleichen sich in allen Branchen. Was Kollegen und Freunde erzählen, wovon die Controllingabteilungen der Unternehmen berichten, was die Studien der Krankenkassen ermitteln, der Stressreport der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – dies alles ergibt ein sich wiederholendes Muster. Es ist das Muster einer Steigerung, die an ihre Grenzen gerät. Aber was sollen wir tun mit dieser Erkenntnis?
Es hilft, sich diese Grenze, die möglicherweise bald erreicht wird, als Schwelle vorzustellen. Es hebt den Blick für das, was danach kommt. Zwar funktionieren bestimmte Mechanismen nicht mehr, die uns über 20, 30 Jahre begleitet haben, aber es werden sich neue entwickeln. Methoden und Mechanismen, die sich sinnvoll einer sich ständig wandelnden Welt anpassen können.
Was uns bevorsteht, ist kein quantitativer, sondern ein qualitativer Wechsel. Es kann nicht mehr darum gehen, dasselbe schneller, öfter und mehr zu machen, sondern wir müssen etwas Anderes machen. Wie dieses neue Andere aussehen kann, das ist die Grundfrage des von uns entwickelten Slow Media Ansatzes. Er lässt sich auch auf die Arbeitswelt und Unternehmen übertragen: Wie nutzen wir den technologischen Fortschritt sinnvoll? Wie lässt sich ein positives Leistungsklima schaffen und erhalten? Wo lassen sich Dehnungsfugen einbauen, die das Gewebe des Unternehmens vor einem Zerreißen schützen? Welche Perspektive müssen wir einnehmen, um das Ganze sehen und langfristig sinnvoll handeln zu können?
Ein wachsender Organismus mit positivem Leistungsklima
Die Aufgabe für die Zukunft wird sein, sich differenziert mit Wachstum zu befassen. Dazu gehört, die feinen Unterschiede zwischen einem positiven und nährenden Wachstum und einem Wachstum, das verzehrend und zerstörerisch wirkt, zu analysieren. Beispiele für ein ständiges Wachsen hin zum Besseren gibt es: Aus dem Bereich der digitalen Welt ist es der Permanent-Beta-Gedanke von Open Source Software, die sich in der Nutzung und ständigen Rückkopplung kontinuierlich immer weiter verbessert und anpasst. Kulturhistorisch lassen sich Erzeugnisse mündlicher Tradition wie Volksmärchen als eine ständige Optimierung und Anpassung an Bedürfnisse und Erwartungen von Erzählern und Zuhörern verstehen. Der Mensch selbst ist mit seinem lebenslangen Lernen und Wachsen ein gutes Vorbild. Ebenso die menschliche Sprache als System, das sich der verändernden Welt anpasst. Immer sind solche Anpassungs- und Wachstumsprozesse mit der Gratwanderung zwischen Anpassung und Wahrung von Identität und Bezug verbunden.
Auch Unternehmen können sich als wachsenden und lernenden Organismus verstehen und jeden Tag besser werden, ohne sich selbst aufzuzehren. Gefordert ist dabei eine aufmerksame Fehlerkultur, eine Optimierung, die die eigenen Grundannahmen an der Wirklichkeit überprüft und rückkoppelt. Verbesserung heißt: Aufmerksam werden, wenn die Fluktuation unter der Belegschaft steigt, die Resignation, die Ausfallzeiten. Hinhören, wenn gute Mitarbeiter signalisieren: So geht es nicht mehr, wir müssen andere Wege finden. Die Steigerung absolut zu setzen, ohne die Folgen für das Gesamtsystem im Blick zu halten, ist mit zu hohen Kosten verbunden. Wer wachsen will, muss für Dehnungsfugen sorgen. Soll Leistungssteigerung dem Unternehmen langfristigen Erfolg sichern, muss sie im Unternehmen als Ganzes funktionieren.
Was bedeutet das für unseren Satz am Anfang, „Jeder gibt immer sein Bestes“? Ich möchte den Satz gerne modifizieren: „Jeder handelt so, wie es für das Gesamte am besten ist“. Die ständige Maximalleistung des Einzelnen ist dann nicht mehr nötig. Stellen wir uns also für die Zukunft jenseits der Schwelle Unternehmen vor, denen es gelingt, auf dem Weg des Wachstums auch die mitzunehmen, die sie dort brauchen: ihre Kunden, die Qualität ihrer Leistungen, ihre eigene Identität und ihre Mitarbeiter.
_______________________
[Update*]:
Inzwischen (seit November 2013) hat das Unternehmen Microsoft das umstrittene Mitarbeiterbewertungssystem Stack Ranking abgeschafft: http://www.theverge.com/2013/11/12/5094864/microsoft-kills-stack-ranking-internal-structure
Wie lässt sich ein produktives, effizientes und gesundes Leistungsklima in einer digitalen Arbeitswelt etablieren? Lesen Sie hier mehr zum “Interaktionsmdell Digitaler Arbeitsschutz”: http://slow-media-institut.net/digitaler-arbeitsschutz







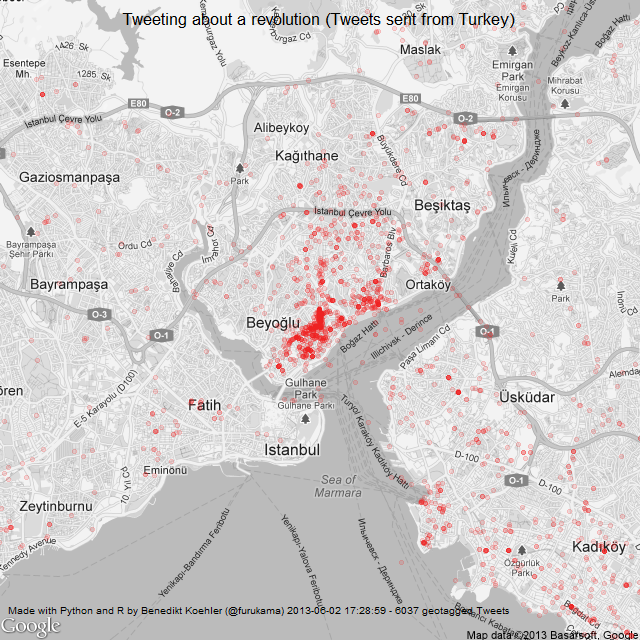


 [Read this post in English]
[Read this post in English]