Medien entstehen, Medien vergehen. Die junge Wissenschaft der Medienarchäologie hat sich vorgenommen, diesen 5000jährigen Entwicklungsstrom von den ersten geritzten Steinen bis Chatroulette genauer zu untersuchen. Wolfgang Riepl hatte 1913 mit dem folgenden Satz eine Art “Naturgesetz” der Medienevolution formuliert:
[D]ie einfachsten Mittel, Formen und Methoden, wenn sie nur einmal eingebürgert und für brauchbar befunden worden sind, auch von den vollkommensten und höchst entwickelten niemals wieder gänzlich und dauerhaft verdrängt und außer Gebrauch gesetzt werden können, sondern sich neben diesen erhalten, nur daß sie genötigt werden, andere Aufgaben und Verwertungsgebiete aufzusuchen.
Je weiter man jedoch in die Vergangenheit blickt, desto häufiger stößt man auf Medienartefakte, ja ganzen Medienkomplexe, die nicht nur in der Gegenwart nicht mehr in Gebrauch sind, sondern für die nicht einmal ihr ursprünglicher Sinn und Zweck rekonstruiert werden kann. Außer eben, dass es sich um Medien handelt, die menschliche Sinne und Denkprozesse einmal auf irgendeine Weise erweitert haben. Im günstigsten Fall geraten Medien nicht vollkommen in Vergessenheit, sondern werden von kleinen Subkulturen als sinn- oder identitätsstiftende Praktiken adoptiert. Die besten Beispiele dafür sind Phänomene wie die Steampunk– oder Retrofuturismusbewegung.
Was z.B. in der Bronzezeit einmal ein Rechenhilfsmittel gewesen sein könnte, wird heute als Talisman verehrt. Oder Steine, in die möglicherweise die Geschichte eines jungsteinzeitlichen Stammes eingeschrieben wurde oder die für die Zeitrechnung verwendet wurden, werden heute als Kraftorte von esoterischen Reisegruppen besucht. Meine Ergänzung zur Rieplschen These wäre:
Je länger der Verlust der ursprünglichen Aufgaben und Verwertungsgebiete her ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mittel, Formen und Methoden von esoterischen Subkulturen adaptiert werden.
Klar ist, es gibt unterschiedliche Grade der Vergessenheit und des Verschwindens von medialen Praktiken. Daher liegt es nahe, für weit verbreitete, bedrohte, ausgestorbene und wiederauferstandene Medien eine Art “Rote Liste der bedrohten Medien” anzulegen analog zu entsprechenden Listen für das Tier- und Pflanzenreich:
0: ausgestorben oder verschollen
1: vom Aussterben bedroht
2: stark gefährdet
3: gefährdet
R: extrem selten
G: Gefährdung anzunehmen
D: Daten mangelhaft
V: Vorwarnliste (noch ungefährdet, verschiedene Faktoren könnten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen)
Eine ähnliche Idee hat Bruce Sterling gemeinsam mit Richard Kadrey 1995 zur Formulierung des “Dead Media Manifestos” gebracht, das zunächst die Rieplsche These im Großen und Ganzen akzeptiert, dann aber relativiert:
[S]ome media do, in fact, perish. Such as: the phenakistoscope. The teleharmonium. The Edison wax cylinder. The stereopticon. The Panorama. Early 20th century electric searchlight spectacles. Morton Heilig’s early virtual reality. Telefon Hirmondo. The various species of magic lantern. The pneumatic transfer tubes that once riddled the underground of Chicago.
Leider ist die Seite des “Dead Media Projects” zur Zeit nicht mehr erreichbar – also bezeichnenderweise selbst zu einem toten Medium geworden -, aber über Seiten wie archive.org sind die zahlreichen Notizen zu ausgestorbenen Medien noch erreichbar, darunter zum Beispiel die militärische Nutzung von Brieftauben, der Volksempfänger, die Sonnentelegraphie (Heliographie), ausgestorbene Techniken von TV-Fernbedienungen wie z.B. die Ultraschallfernbedienung, das PALplus-Fernsehformat, Dioramen und Panoramen oder die Camera Obscura.
Nicht nur ist das Dead Media Project und die vielen dort versammelten Notizen (mit der Aufforderung, daraus etwas zu machen, daran weiterzuarbeiten) ein großartiges Beispiel einer slowen Internetseite, die inspiriert und zum Austausch und Weiterdenken anregt. Sondern die Medienarchäologie ist ein sinnvoller wissenschaftlicher Unterbau für unser Slow Media Projekt, da es wie von selbst zu den Fragen führt:
- Wie bedroht sind die langsamen Medien derzeit?
- Welche Slow Media sind bereits vom Aussterben bedroht?
- Wie sieht medialer Artenschutz aus?
- Was können wir tun, um inspirierende und faszinierende Mediengattungen zu erhalten?
Einen Besuch lohnt auch die Webseite Radiomuseum, auf der es ziele Informationen über ausgestorbene Rundfunktechnologien gibt. Oder diese Seite mit Abbildungen gängiger Audiokassetten.




 [Read Post in English]
[Read Post in English]
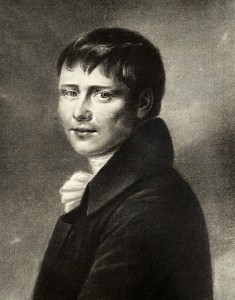
 “Every time I hear about Twitter I want to yell Stop. The notion of sending and getting brief updates to and from dozens or thousands of people every few minutes is an image from information hell. It scares me, not because I’m morally superior to it, but because I don’t think I could handle it.”
“Every time I hear about Twitter I want to yell Stop. The notion of sending and getting brief updates to and from dozens or thousands of people every few minutes is an image from information hell. It scares me, not because I’m morally superior to it, but because I don’t think I could handle it.” “We know a lot about digital technology, and we are bored with it. Tell us something we’ve never heard before, in a way we’ve never seen before.”
“We know a lot about digital technology, and we are bored with it. Tell us something we’ve never heard before, in a way we’ve never seen before.”







