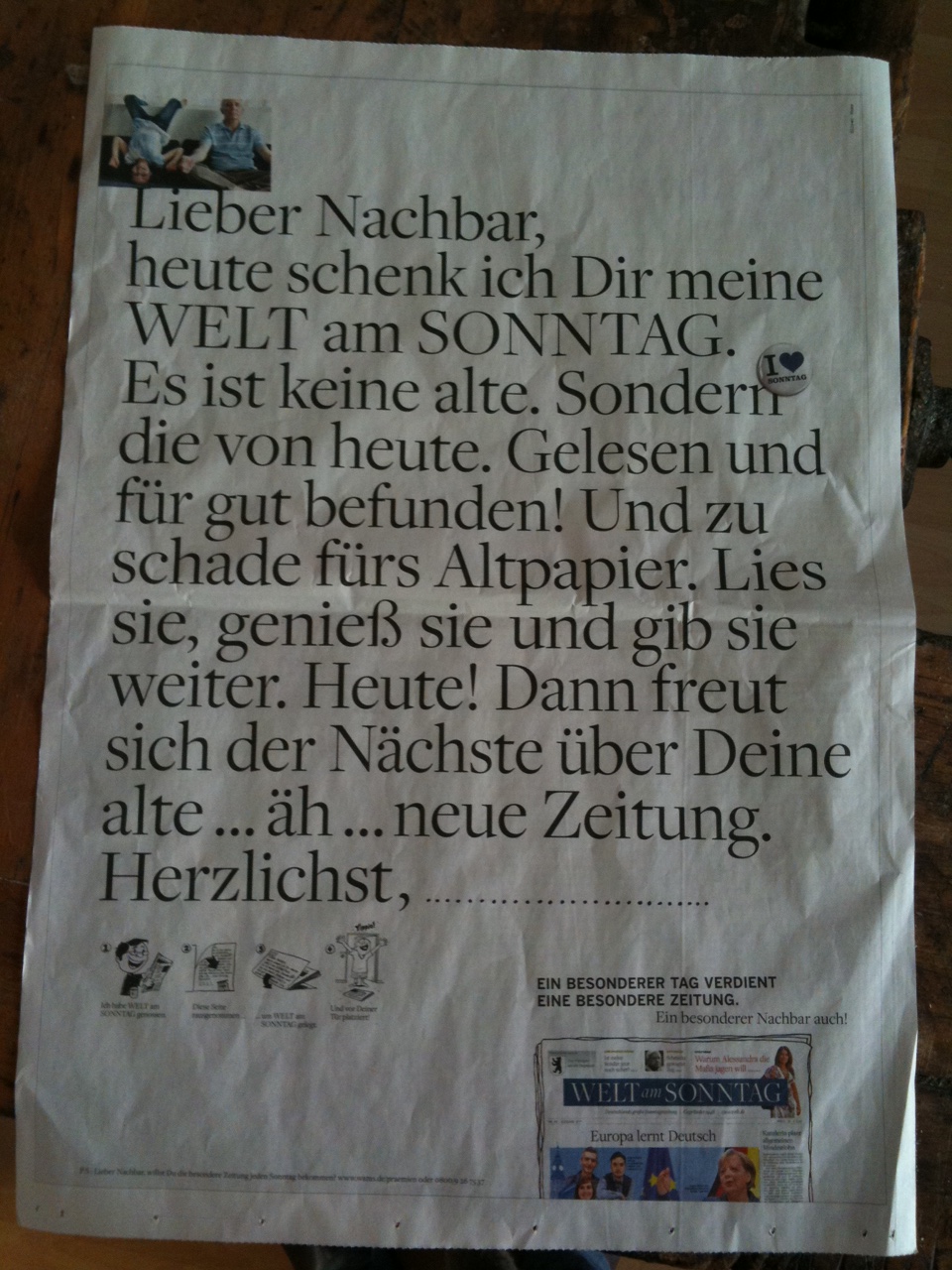Vor ein paar Tagen wollte ich eine Zeitung kaufen. Am liebsten kaufe ich Zeitungen in einem Kiosk. Meinen Lieblingskiosk um die Ecke, der mich jahrelang begleitet hat, gibt es leider nicht mehr. Dort stand die füllige Nichtraucherin Nada, umhüllt von Rauchschwaden ihrer Dauergäste (manche mit Hund, manche nur mit viel Zeit), hinter der Theke. Ich bekam zwischen Schulheften und sauren Zungen meine Zeitung mit einem Nachbarschaftsplausch überreicht. Gut. Temps passés. Ihr Arbeitsalltag war sicher hart und nicht jedem zu empfehlen.
Aber mit ihr verschwanden vor ein paar Jahren auch die anderen traditionellen Kioske aus dem Viertel. Es machten neue Kioske auf. Auch dort sind die Menschen hinter der Theke nett. Sie verkaufen saure Zungen, Sim-Karten und Biermixgetränke. Sie achten gut auf die Nachfrage der Nachbarschaft. Was die Schulkinder gerne knabbern, gibt es dort in der nächsten Woche zu kaufen.
 Sie verkaufen aber keine Zeitungen. Kioske ohne Zeitungen, eine neue Gattung. Manchen haben zwar noch einen Zeitungsständer mit ein wenig Papier, aber es sind eher Feigenblätter, glaubwürdiges Kiosk-Kolorit.
Sie verkaufen aber keine Zeitungen. Kioske ohne Zeitungen, eine neue Gattung. Manchen haben zwar noch einen Zeitungsständer mit ein wenig Papier, aber es sind eher Feigenblätter, glaubwürdiges Kiosk-Kolorit.
Was bedeutet es, dass es Kioske ohne Zeitungen gibt?

Schließlich fand ich stadteinwärts doch noch einen Zeitungs-Kiosk. Die Zeitschrift, die ich suchte, hatte der Kioskbetreiber aber nicht. Er habe nie von ihr gehört, sagte er. Zum Beweis zeigte er auf das schmale Regal, in dem die Zeitschrift offensichtlich doch stand. “Ah, tatsächlich”, sagte er auf meinen Hinweis. “Ist mir nie aufgefallen.” Er wirkte nicht irritiert. Er hätte genausogut irgendetwas anderes verkaufen können, Autoreifen oder Haarwuchsmittel. Wie im Supermarkt, der das wahrscheinlich noch größte Sortiment an Presseerzeugnissen hat. Ich mag meinen Supermarkt. Aber wen frage ich da, wenn ich eine Frage zu einem der Produkte habe?
Aus dem Bereich Papier stammt auch die Meldung, dass Thalia im kommenden Jahr die Bonner Universitätsbuchhandlung Bouvier schließen wird. Die 185 Jahre alte Fachbuchhandlung, die in Steinwurfweite zur Universität liegt, wird zugunsten der Thalia Zweigstelle im nahegelegenen ehemaligen Metropol aufgegeben, einer Art Convenience Medien Kaufhaus. Nur auf den zweiten Blick kann man hier hinter den bunten Geschenkartikeln Bücher entdecken. Die Buchhändler sollen, so sagt eine Geschäftsführerin der zu Douglas gehörenden Thalia-Gruppe, intern bei Thalia oder “woanders bei der Douglas-Holding” untergebracht werde. Ich bezweifle, dass das eine gute Nachricht ist. Müssen wir uns einen Buchhändler in einem Kosmetikkaufhaus vorstellen? Wie kommt man auf die Idee, dass das eine gute Idee sein könnte? Zwar ließen sich Verbindungen zwischen Parfums, Gerüchen und Marcel Proust herstellen. Aber das dürfte kaum reichen.
Der Geist, der hier durchweht, ist der: Es geht nur um das Verkaufen. Welches Produkt verkauft wird, ist austauschbar. Zeitungen, Geschenkartikel, Bücher, Faltencremes, einerlei. Wer das verkauft, muss keinen Bezug dazu haben. Der Unterschied zwischen einem Feinkostladen und einem Supermarkt ist ebender: Dass der Feinkosthändler einen Bezug zu den Dingen hat, die er verkauft, weiß wo sie gewachsen sind, und wie sie zubereitet werden.
Ein Kommentator eines Beitrags im Börsenblatt stellt zu den Fehlern des Bouvier-Vorbesitzers Grundmann fest: “Schon ihm schwebte eher ein Kaufhaus, das auch Bücher verkauft, vor.” Das passt zu Schuldirektoren, die ebenso effizient eine Justizvollzugsanstalt verwalten und leiten könnten. Alles ist austauschbar.
Was dabei verloren geht, ist die Bindung. Der Bezug zu den Dingen, die einen umgeben, die man empfiehlt und verkauft, zu den Menschen die man leitet und führt, die man verwaltet und betreut. Wo alles auf ein maximal verkaufbares Produkt reduziert wird, geht Identität und Bindung verloren. Entfremdung, ich weiß, ein altbackenes Wort, aber hier trifft es zu.
Eine Längsschnittstudie der Harvard-Universität untersucht seit über 70 Jahren, was Menschen glücklich macht. “Das mit Abstand wichtigste ist die Bindung”, sagt der Leiter der Studie. Die Fähigkeit, Bindung zu Menschen herzustellen, sicher auch Bindung zu der Welt und zu sich selbst. Sind wir auf dem Weg, eine bindungslose und damit unglückliche Gesellschaft zu werden? Innerhalb einer Gesellschaft hat auch Kultur die Aufgabe, Bindungsfähigkeit herzustellen. Sie schafft Identität und ermöglicht es Menschen, sich zugehörig zu fühlen. Sie stellt einen Bezug her zwischen den Menschen und der Welt, der Gemeinschaft, in der sie leben.
Anstatt im Supermarkt meine Zeitung zu kaufen, gehe ich manchmal in das Café um die Ecke. Es hat wohltuend viel Papier-Druckwaren abonniert. Ich halte mit der Kellnerin einen Plausch und bestelle einen Milchkaffee. Dort sitze ich unter Tätowierten und lese mich quer durch den Blätterwald.
__________________
Nachtrag:
Das Buch im Kauftempel als bindungslose und austauschbare Konsumware neben anderen Konsumartikeln – das war das Konzept von Thalia. Als Grund dafür, dass dieses Konzept nicht aufgeht, nennt Thalia/Douglas den “aktuellen Branchenumbruch”. Man sollte sich hier vor einem Verständnisreflex hüten.
Zwar hat das Internet vieles ausgelöst. Es ist jedoch die Frage, ob es in diesem Fall wirklich der aktuelle Branchenumbruch selbst ist, der ruinös war, oder eher die unternehmerische Reaktion auf ihn.