“Mach mich wieder froh.” (Psalm 51,14)
Das ist die Bitte aus dem Psalm zum Beginn der Fastenzeit am heutigen Aschermittwoch.
Trotz eines anhaltenden Trends zum Heilfasten kann man allerdings kaum davon sprechen, dass Fasten und besonders Buße im alltäglichen Sprachgebrauch mit Freude in Verbindung gebracht werden. Man mag darin doch die Sinnesfeindlichkeit und den Hang zur Trieb-Unterdrückung konzentriert sehen, welche dem Christentum gerne unterstellt werden. Fasten bleibt, bei allen Versuchen zur Säkularisation, in der spirituellen – wenn nicht gar Eso-Ecke.
Die aktuelle Rede vom Medien-Fasten regt entsprechend zu hitziger Diskussion an, bei der beide Seiten einander unterstellen, religiös und nicht objektiv zu argumentieren. – Nicht ganz von ungefähr, hatte doch sogar Benedikts XVI., immer für einen Aufreger gut, im Angelus vom 17.2.2008 die Medien-Enthaltsamkeit zur Unterstützung der inneren Sammlung und Reinigung empfohlen:
“Dazu kann es auch nützlich sein, von der Fülle und Flut an Stimmen und Bildern in unserem Alltag für eine Weile Abstand zu nehmen.”
***
Fasten und Diät sind Begriffe, die im Zusammenhang mit Slow Media an verschiedenen Stellen auftauchen, wenn es um den Wunsch nach Heilung einer von manchen empfundenen Überforderung geht, oder um die Unsicherheit, wieweit das eigene Leben inzwischen schon von Medien und insbesondere dem Internet abhängt. In Ihrem Blog schreibt Jana Herwig unter dem Titel “Twitter-Fasten: Ich tu’s (aber nicht für Schirrmacher und Kluge)”:
“Aber manchmal möchte ich auch wieder ohne diesen [Social-Media-Sinn] sein, möchte nicht in der U-Bahn und in anderen handlungsarmen Momenten zum Smartphone greifen, um zu schauen was sonst los ist, möchte dem Impuls, sich artikulierende Gedanken auch auf Twitter zu verfestigen, mal nicht nachgehen, nicht wissen, wie andere darauf vielleicht reagieren, sondern es nur für mich behalten.”
Auf diesen Beitrag bezieht sich auch Luca Hammer, nach seiner Selbsteinschätzung Autor von bis zu 800 Tweets pro Monat:
“Täglich mehrere Stunden, die ich damit verbringe Tweets zu lesen und zu schreiben. Hochfrequent. Ständig im Kopf. Was würde passieren, wenn ich diese Zeit fürs bloggen einsetzen würde?”
Und auch Ibrahim Evsan, der kaum als Internetskeptiker gelten dürfte, verordnet sich von Zeit zu Zeit eine Internet-Diät: “Wenn ich zu schwer werde, muss ich weniger konsumieren und mich mehr bewegen, wenn mir die Zeit für das reale Leben in der digitalen Welt ‘abhanden’ kommt, muss ich dafür sorgen, dass ich den Social Media Konsum optimiere”
***
Buße, μετάνοια, wie in der Begriff im griechischen Evangelientext heißt, bedeutet wörtlich Um-Denken und nicht Strafe, anders, als uns dies heute in Wörtern wie Bußgeld, abgeleitet aus der Lateinischen Übertragung poenitentia mitschwingt. Um umdenken zu können, forderte Benito Cocchi, der Erzbischof von Modena in der Fastenzeit freiwillig an einem Tag der Woche auf SMS, Internet und Fernsehen zu verzichten und so wieder eine Verständiung zu pflegen und nicht nur Kommunikation zu betreiben: “Per tornare a comunicare, invece di komunikare”.
“Denn in der pluralistischen Gesellschaft kommt alles wahllos zur Sprache, was nur immer Neuheit und Sensation verheißt.[…] Doch man muß zu einer kritischen Reife erziehen, die mit Weisheit zu wählen versteht.”
redet Benedikt XVI. seinen deutschen Bischöfen beim Ad-Limina-Besuch ins Gewissen (ohne ihnen damit aber eine Ausrede zur Internet-Verweigerung zu spendieren, denn: “Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die Euch erfüllt” (1 Petr 3,15).”).
Fasten, sagt Thomas von Aquin “… soll die Begierde des Fleisches zügeln, dem Geist die Betrachtung des Erhabenen erleichtern …”.
Durch das Abstand nehmen kann der Blick frei werden, auf die Folgen, die durch unsere Kommunikations-Apparate in der Welt entstehen. Und Benito Cocchi meint damit auch ausdrücklich die materiellen Folgen, denn ein großer Teil unserer elektronischen Ausrüstungen wird durch die abscheulichste Form von Ausbeutung erzeugt, was man sich wohl viel zu selten bewusst macht – und woführ jeder von uns gefälligst ein Stück Verantwortung übernehmen sollte. Bei aller CSR-Rhetorik von der Green IT müssen wir uns doch vor Augen führen lassen, dass wir von Nachhaltigkeit bei unserem Medienkonsum noch sehr weit entfernt sind!
***
Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen wie die Heuchler; denn sie verstellen ihr Angesicht, auf daß sie vor den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. […] Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht (Mt 6,16-17)
Fasten soll keine Last sein, auch das Medien-Fasten nicht; es möge uns (wieder) froh machen!
Es mag uns einen Anlass geben, über die eigene Verwendung der Kommunikationsmittel nachzudenken, kritisch über die Inhalte zu sehen und auch mit dem nötigen Abstand ein Bild der eigenen, vielleicht zum Glück doch nicht so zentralen Position im Sozialen Netz zu gewinnen:
Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. (Gen 3,19)
 [Read this Post in English]
[Read this Post in English]
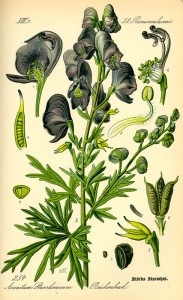

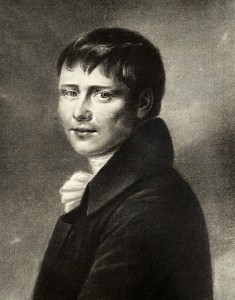
 “Every time I hear about Twitter I want to yell Stop. The notion of sending and getting brief updates to and from dozens or thousands of people every few minutes is an image from information hell. It scares me, not because I’m morally superior to it, but because I don’t think I could handle it.”
“Every time I hear about Twitter I want to yell Stop. The notion of sending and getting brief updates to and from dozens or thousands of people every few minutes is an image from information hell. It scares me, not because I’m morally superior to it, but because I don’t think I could handle it.”