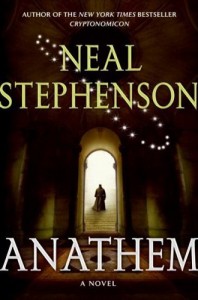Eine der spannendsten Gedanken zum iPad war in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu lesen (und teilweise auch hier zu hören). Darin beschreibt Frank Schirrmacher das neue Wundergerät von Apple – angekündigt wird es als magisch und revolutionär – als erste digitale Medienplattform mit Slow-Media-Features.
Eine der spannendsten Gedanken zum iPad war in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu lesen (und teilweise auch hier zu hören). Darin beschreibt Frank Schirrmacher das neue Wundergerät von Apple – angekündigt wird es als magisch und revolutionär – als erste digitale Medienplattform mit Slow-Media-Features.
Das immer wieder bemängelte fehlende Multitasking, die wenigen Geräte-Schnittstellen und die vergleichsweise wenigen veränderbaren Benutzereinstellungen verwandeln sich nämlich im Kontext der Slow-Media-Bewegung zu einem zukunftsweisenden Feature-Set, das eine viel stärkere Konzentration auf die abgerufenen (immer häufiger: gekauften) Inhalte fordert. Damit macht dieses Gerät vielleicht tatsächlich digitale Medien auf eine Weise rezipierbar, die bislang Medien wie dem gedruckten Buch vorbehalten war:
Jetzt verkörpert die Hardware diese Philosophie. Multitasking ist Körperverletzung, lautet ein heftig umstrittener Satz. Apples Hardware verschont den Konsumenten, indem sie ihm gar keine Wahl zum Multitasken gibt. Allein das ist ein Bruch mit der klassischen Cyber-Anthropologie, in der der Mensch sich seine Welt bis in die Mikrostruktur zusammenstellt.
Paradoxerweise hört man bis jetzt vor allem die Stimmen derer, die mit diesem Gerät vermutlich gar nicht gemeint sind. Nicht die knapp 10 Prozent “jungen hyperaktiven” Routineonliner scheinen hier die Zielgruppe zu sein, sondern die Selektiv- und Randnutzer, für die das Internet kein Social Network, sondern eine digitale Bibliothek ist. Für die 71% der deutschen Online, die angeben, nie Social Networks zu verwenden, oder die 91%, die nur minimal in das “Mitmachnetz” involviert sind.
Ich glaube, dass Frank Schirrmacher in einem Punkt irrt. Er bezeichnet das iPad als “Restauration”. Das stimmt nicht. Das iPad bringt uns nicht zurück ins Gutenberg-Zeitalter. Nicht einmal in die Nähe davon.
Was wir hier erleben, ist eine Gegenreformation, in der nicht die alte Ordnung wiederhergestellt wird, sondern eine Radikalisierung, Expansion und innere Erneuerung der digitalen Kultur. Die Einführung des iPad, die von einigen Kommentatoren bereits als Ende der PC-Ära gesehen wird, ist eine Art digitales Tridentinum, in dem sich die Internetkultur soweit reformiert und klärt, dass sie ihren alten konservativen Kritikern und Verweigerern keine Angriffsfläche mehr bietet.
Vielen Dank an @pramesan für diesen Hinweis auf Twitter.
 “We know a lot about digital technology, and we are bored with it. Tell us something we’ve never heard before, in a way we’ve never seen before.”
“We know a lot about digital technology, and we are bored with it. Tell us something we’ve never heard before, in a way we’ve never seen before.”