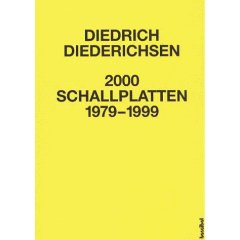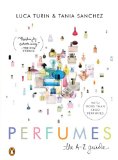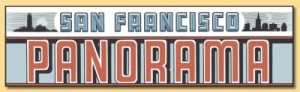 Ein Gastbeitrag von Christoph Bieber
Ein Gastbeitrag von Christoph Bieber
Gefühlte anderthalb Kilo wiegt das „SF Panorama” und dass diese „Zeitung” tatsächlich in Deutschland verfügbar ist, verwundert einen dann doch. Zu verdanken ist es Amazon, und eben nicht dem (ehemals) „gut sortierten Buchhandel” – die einmalige Ausgabe dieses bezaubernden Sonderdrucks müssen Liebhaber des gedruckten Wortes über das Internet bestellen. Im Look & Feel einer prall gefüllten Wochenendzeitung kommt die Ausgabe Nummer 33 des hierzulande kaum bekannten “McSweeney´s Quarterly Concern” daher. Die Vierteljahresschrift mit dem Retro-Namen ist eigentlich ein Literaturmagazin, bei dem jede neue Ausgabe in Inhalt und Form massiv von der Vorgängernummer abweicht.
Zudem ist das „Quartely Concern“ Teil eines unwahrscheinlichen Medienimperiums, das auch ein Monatsblatt (The Believer), ein DVD-Magazin (Wolphin) und einen eigenen Buchverlag unterhält – dahinter steht das Medienmultitalent Dave Eggers. Neben den subtilen Beiträgen zur klassischen Verlangsamung der Medienwelt ist McSweeney´s aber auch online sehr präsent, die Website McSweeney’s Internet Tendency wird mittlerweile flankiert von einen Twitter-Account und einer im Halbjahres-Abo verfügbaren iPhone-App.
Anfang Dezember ist nun das San Francisco Panorama erschienen, als Beitrag zur gerade in der Bay Area massiv geführten Debatte um die Zukunft der Printmedien. Lokales Zentrum der „Newspaper Angst“ ist das Schicksal des San Francisco Chronicle, denn das große Westküstenblatt steht am Abgrund – obwohl es täglich gut recherchierten Qualitätsjournalismus liefert, der auch den Blick auf das Weltgeschehen nicht verloren hat.
Der „Beipackzettel“ des SF Panorama, etwa im Format eines LP-Covers gehalten, versammelt Anmerkungen zum Entstehungsprozess (On Design, On Young Readers, On Definitiveness…) und schlüsselt den finanziellen Aufwand für die einzelnen Zeitungsbücher sowie die Druckkosten auf. Außerdem liest sich das „Information Pamphlet“ wie ein Hilfsrezept für die strauchelnden Zeitungsverlage im ganzen Land. Das Understatement dieser Kommentare ist dabei entwaffend – der Schlüssel zur Nachhaltigkeit des Projekts steckt im Angebot seiner Nachahmung.
Die Web-Version des SF Panorama kann die Opulenz des Projektes freilich nur andeuten – und genau das ist auch gewollt:
„We went into this knowing that print has to look different than the internet. (…) A big sheet of paper can give you the big picture and the details all at once.”
Das klingt zwar nach „leicht gesagt”, wird aber mit jedem Blick auf eine beliebige Seite der Einmal-Zeitung nachdrücklich bestätigt.
„Slow“ ist das Blatt nicht wegen des maximal seltenen Erscheinungstermins, die Leser erhalten ein in mehrfacher Hinsicht perfektes Medium. Das Layout ist präzise und verführend zugleich, Hauptteil und Beilagen bestechen durch extreme Schauwerte. Auratisch sind nicht nur die Comic-Seiten, Steven Kings Medititation über die vergangene World Series im angemessen langsamen Baseballsport ist es auch. Dialog und Diskurs hat das Projekt schon vor der Veröffentlichung gesucht – die Titelstory zur neuen Brückenverbindung zwischen Oakland und San Francisco wurde über Spenden an das Portal spot.us finanziert. Ein gutes Beispiel für hochwertige Arbeit, ermöglicht durch community funded journalism – eine hierzulande noch extrem seltene Ausprägung von Prosumenten-Aktivität.
Kurzum: Das San Francisco Panorama ist ein wunderschöner Kontrapunkt aus dem Herzen des globalen Beschleunigungszentrums und der Beweis dafür, dass an der Westküste nicht nur der Twitter-Takt die Medienzeit vorgibt.